reden über schreiben über film(e): #8 Jochen Werner
Von Marco Siedelman // 25. Juni 2014 // Tagged: featured, Interview // 2 Kommentare

 Menurut CV singkat Anda, Anda belajar bahasa Jerman dan studi media di Potsdam Seberapa awal Anda menyadari bahwa film akan menjadi hal utama bagi Anda?
Menurut CV singkat Anda, Anda belajar bahasa Jerman dan studi media di Potsdam Seberapa awal Anda menyadari bahwa film akan menjadi hal utama bagi Anda?
Pada dasarnya, bagi saya pribadi, itu selalu. Saya tumbuh di bioskop dan saya membutuhkannya dan masih membutuhkannya seperti udara yang saya hirup. Namun, saya selalu memiliki keraguan tertentu tentang konsep, hasrat untuk melakukan sesuatu. pekerjaan, meskipun saya telah bekerja ke arah ini untuk sementara waktu, tetapi saya selalu melihat bahaya bahwa kegembiraan pekerjaan, betapapun menyenangkannya, sering hilang jika Anda melakukannya tiba-tiba untuk bertahan hidup, jadi saya memilih yang berbeda jalan: mata pencaharian saya hari ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang saya lakukan di sekitar bioskop: Saya bekerja sebagai editor di sebuah organisasi budaya besar yang tidak ada hubungannya dengan film – pekerjaan yang sangat saya sukai dan memberi saya struktur yang cukup dalam keseharian saya kehidupan,sehingga proyek-proyek terkait film yang saya lakukan sebagai penulis atau kurator secara sukarela atau dengan bayaran yang sangat kecil bukanlah pekerjaan upahan, melainkan ekspresi kecintaan saya pada sinema di waktu luang saya.
Bagaimana Anda mendapatkan ide untuk menulis tentang film dan di mana Anda menempatkan rilis pertama Anda?
Selama studi saya, saya bertemu dengan beberapa rekan mahasiswa yang menerbitkan majalah budaya kecil – majalah orang jahat untuk budaya kontemporer – dan di situlah saya mulai menerbitkan artikel pertama saya. Ulasan film pertama saya yang diterbitkan adalah Suicide Circle yang luar biasa dari Sion Sono, kemudian saya mulai menerbitkan ulasan dan esai pendek di sana secara teratur, kemudian saya menjadi anggota dewan redaksi dan akhirnya saya menjalankan “ Gambar“ yang mengeksplorasi semua bentuk seni visual. Itu berlangsung selama beberapa tahun, tentu saja dengan basis eksploitasi diri, dan setelah kami menutup majalah tersebut saya mulai mencari tempat lain untuk menerbitkannya.Awalnya saya rutin menulis untuk F.LM – teks tentang film,majalah online teman saya Stefan Höltgen, lalu untuk pengeditan, Splatting Image, dll. Pada titik tertentu semuanya akan menjadi mandiri, dan begitu Anda memiliki sedikit kehadiran sebagai penulis, proyek menarik juga didekati.
Sedikit rasa ingin tahu: Sarjana film lain yang berbahasa Jerman, saat ini aktif juga disebut Jochen Werner (termasuk publikasi buku tentang karya Aki Kaurismäki). Pernahkah Anda membacanya? sebuah anekdot?
Saya tidak bertemu dengannya, hanya membaca dan mengulas bukunya. Namun ada satu anekdot, yang sangat bagus. Pada saat buku itu diumumkan, saya berada di Bertz + Fischer Verlag berkolaborasi dalam „publikasi pesaing“, dan kemudian asisten penerbit, Barbara, menulis kepada saya di beberapa titik melalui kurir internal: „Um, beri tahu saya, Jochen – Apakah Anda pernah menulis buku tentang Aki Kaurismäki?“ Sayangnya saya harus mengatakan tidak, saya hanya di jejak kompetisi.
Anda adalah seorang penulis yang bersemangat, teks Anda sering dibaca dengan sangat sensual dan dengan senang hati, Anda tidak berhenti pada referensi pribadi atau memiliki pemikiran umum tentang cinta, seksualitas, hubungan antarpribadi, dll. saat yang sama ketika Anda menelusuri film?
Das lässt sich für mich nur schwerlich trennen, beziehungsweise: Da ich ja auch eine akademische Ausbildung im Umgang mit Film und Kunst allgemein habe, ließe sich das schon trennen, aber das ist nichts, was mich (noch) interessiert. Ich weiß auch nicht, ob „aufbohren“ da das richtige Wort ist, ich möchte nichts aufbrechen, auch nichts aus einem Film „herausholen“, das Wort finde ich noch schlimmer. Eher möchte ich das, was da sein mag, darinlassen, den Film intakt lassen, etwas herantragen – vielleicht auch mich –, etwas hinzufügen, nichts wegnehmen. Eine Poesie beschwören und mich dem Magischen nähern, das mich am Kino immer wieder ergreift. Ich will da auch keinen Maßstab, an den ich Filme anlege, ich will da im Idealfall als weißes Papier herangehen und eruieren, was ein Film mit mir macht. Und dann eine Sprache finden, die dieses sinnliche Erleben transportiert. Was ich inzwischen am allerwenigsten will, ist ein Empfehlungsjournalismus, im Sinne von: dieser Film ist euer Geld und eure Zeit mehr oder weniger wert als jener. Eher soll aus jedem meiner Texte die stumme Aufforderung sprechen: Lasst euch auf das Kino ein, lasst zu, dass es etwas mit euch macht. Wenn ich über einen Film schreibe, schreibe ich auch immer über: das Kino.
Nicht selten überraschst du mit Superlativen, mit großer Liebe für vielgeschmähte oder verrissene Filme. Teil zwei bis sieben der „Saw“-Reihe bezeichnest du ohne viel Rückhalt von anderen Schreibern oder Filmwissenschaftlern als „Meisterwerke“ und findest oft poetische Worte für Filme, zu denen man solche nicht unbedingt erwartet. Konntest du schonmal feststellen, dass du anders eingestellte Antennen hast als der Großteil der Cineasten und Filmschreiber?
Naja, hier und da werden mir mal Dinge wie Ironie oder Provokationswille unterstellt, aber damit kann ich mich nicht identifizieren. Nicht dass ich für Letzteres – die gezielt gesetzte Provokation, das konsequente Beziehen antagonistischer Positionen, wie es etwa ein Armond White betreibt – nicht Verständnis hätte, ich finde durchaus, dass das eine wichtige diskursive Funktion als Gegengewicht gerade zu einem scheinbar ubiquitären Konsens, einnehmen kann. Aber mir selbst ist das zu langweilig. Mein Hang zu einem gewissen inflationären Gebrauch von starken Worten wie „Meisterwerk“ kommt nicht aus einer destruktiven Position wie Ironie heraus, sondern aus einer Erfahrung von Liebe. Wenn ich Saw II – VII sehe, dann machen die Filme etwas mit mir, was ich sehr genieße, sie schicken mich auf eine sinnliche Reise, in der ich aufgehe. Das Wort „Meisterwerk“ bedeutet bei mir übrigens nicht zwingend „Makellosigkeit“, im Gegenteil: Ich habe eher gewisse Vorbehalte gegen die Kontrollfreaks unter den Filmemachern. Heute also etwa: die Hanekes oder Nolans. (Kubrick war zu gut, der passt da nicht so recht hinein, aber trotzdem.) Wenn jedes Detail in einem Werk eine Funktion hat und darin funktioniert, dann wird ein Kunstwerk schnell zur luftdicht versiegelten Maschine zur Sinnherstellung, das ist mir suspekt. Ich mag eher das grandios Auseinanderfallende, das Disparate, das sich hemmungslos in nicht zwingend Zueinanderpassendes Stürzende. Wie die Poesie plötzlich durch das Aussetzen des Handwerks in einen eigentlich durch und durch generischen Film eindringt: Wenn in einer Actionsequenz in einem Steven-Seagal-Film eine Einstellung eine halbe Sekunde zu lang stehen bleibt und sich daran die gesamte Dynamik der Sequenz neu auszurichten gezwungen ist. Wenn das immer unübersichtlichere Figurenensemble in Saw V einen ganzen Film lang durch schummrige Erinnerungsräume schleicht. Wenn das Movens des Narrativen so, freiwillig oder zufällig, still gestellt wird – dann bricht oftmals die Poesie sich Bahn.
Hat sich das Mitteilungsbedürfnis gewandelt, seit du beruflich über Film schreibst. Kommt man dann überhaupt noch zu den Ursprüngen zurück, als man ganz aus sich heraus Texte geschrieben hat oder verändern einen Berufsleben und Auftragsarbeiten da?
Ich habe zwischendurch mal ein gutes Jahr lang tatsächlich Texte zum Geldverdienen geschrieben, und ich bin momentan sehr froh, dass es eigentlich wieder genau so ist, wie Du es schilderst: dass ich Texte nur noch schreibe, wenn ich aus irgendeinem Grund Lust darauf habe. Wenn sich damit hier oder da ein paar Euro dazuverdienen lassen, gerne. Aber ich nehme zur Zeit eher keine reinen Auftragsarbeiten an, wenn mich der Gegenstand nicht ohnehin reizt.
Du hast neben einer Vielzahl von Online-Artikeln und auch im Print bei den meisten relevanten deutschen Magazinen veröffentlicht. Dabei sind ganz unterschiedliche Textsorten. Schreibst du noch lieber, wenn der Text am Ende in einem Hardcover-Sammelband erscheint oder machst du keinen Unterschied? Genießt du es dennoch, auch gedruckt deinen Namen zu sehen?
Kurz und gut: ja. Ich habe inzwischen zu einer ganzen Reihe von, wie ich finde: sehr schön geratenen, Büchern beitragen dürfen, an der Seite vieler hochgeschätzter Kollegen, und es ist immer wieder eine Freude, das gedruckte Buch dann schlussendlich in Händen zu halten. Ob ich dann anders schreibe, weiß ich nicht – vielleicht betreibe ich hier und da mal noch etwas umfassendere Recherchen vor dem Schreiben. Im Moment etwa schaue ich mich, für den im nächsten Jahr bei Bertz + Fischer erscheinenden Sammelband, durch das Gesamtwerk von John Badham durch, um dann schließlich über sein Kinodebüt The Bingo Long Travelling All-Stars and Motor Kings zu schreiben. Das habe ich im Falle meiner Buchbeiträge zu Dario Argento und Joe Dante ähnlich gehandhabt, und das ist mir jedesmal eine große Freude. Aber es ist natürlich nicht möglich, für jeden Text 10-20 Filme in Vorbereitung zu schauen, auch wenn mir das ein Ideal schiene. Aber ich glaube eher nicht, dass ich dann grundsätzlich anders schreibe – ich richte mich eigentlich nicht am Medium oder an einer angenommenen Leserschaft aus. Ich schreibe eine Filmkritik, wie ich ein Gedicht schreiben würde, und das ist ja auch eine höchst persönliche Angelegenheit.
Als Kurator bist du seit Beginn zentraler Mitwirkender am Pornfilmfestival in Berlin. Unter den vielen kleinen unabhängigen Festivals sicher eine Perle, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Vielleicht erzählst du wie es zur Gründung des Festivals kam? Hattest du dich vorher bereits intensiv mit dieser Filmspielart beschäftigt?
Nun, ich bin als Kurator seit dem 2. Festival dabei. Jürgen Brüning hat das Pornfilmfestival 2006 im Alleingang gegründet und kuratiert, und ich war damals als Journalist dort akkreditiert. Ich habe mir tagsüber das Programm angeschaut, kam nachts heim und habe eine Kritik geschrieben, die dann am nächsten Morgen online erschienen ist. Diese Texte haben Jürgen dann wohl so gut gefallen, dass er mich gegen Ende des Festivals fragte, ob ich nicht Teil des fünfköpfigen Kuratorenkollektivs sein wolle, das er für das zweite Festival zusammenstellen wollte. Lustigerweise habe ich vor dem ersten Festival vermutlich mehrere Jahre gar keinen Porno gesehen – ich war zuvor nie leidenschaftlicher Porno-„Konsument“, hatte vor dem ersten Festival auch eher nur den ja nach wie vor ziemlich unerträglichen Videothekenmainstream gekannt. Ich kam damals eher über die Versuche des Independentkinos an das Thema heran, Hardcore-Sex zu integrieren: Chéreau, von Trier, Mitchell, Breillat, Noé. Das fand ich spannend, und da ich mich immer schon für das Kino in den Grenzbereichen und Tabuzonen interessiert habe, war ich sofort Feuer und Flamme – für die Idee des Festivals, so wie ich sie begriff: die Perspektive umzudrehen, ein Genre als Kunst zu betrachten, das zumeist weder als Kunst produziert noch rezipiert wird. Einen Film auf die Kinoleinwand zu werfen und so als Spielfilm zu rezipieren, der explizit im Hinblick auf den TV-Screen und die Vorspultaste entworfen wird. (Im „Golden Age of Porn“, das ich dann recht bald entdeckte und zu lieben lernte und dem wir 2012 beim Pornfilmfestival eine große Retrospektive widmeten, war das grundsätzlich anders, eh klar.) Zu sehen, was das mit dem Film macht und was mit dem Zuschauer. Ich finde diesen Kontextwechsel nach wie vor spannend, ich würde auch gern mal ein DTV-Filmfestival machen – ein Kinofestival, in dem nur Videopremieren gezeigt werden.
Nur wenige Magazine oder Festivals berücksichtigen Pornofilme als seriös zu behandelnde und qualitativ voneinander stark divergierende Kunstform. Das ist bei dir klar anders. Wünschst du dir mehr Anknüpfung an die Pionierarbeit der Splatting Image? Dort erhalten schon lange Jahre auch aktuelle Pornoproduktionen ihre cinephile Betrachtung, ohne das den Texten das schmierige Nerdgrinsen im Gesicht steht.
Dieses ganze selbstironische Nerd-Ding finde ich generell nicht so interessant. Jede Perspektive, die sich über ein Kunstwerk stellt, finde ich einfach abgeschmackt und überheblich, mich interessiert die Poesie auch an entlegenen, unzugänglich scheinenden Orten, nicht das Potenzial, mich über einen Film (oder dessen Rezipienten) lustig zu machen und mich selbst dadurch zu profilieren. Also ja, ein Anknüpfen an die alterwührdigen „Pornotions“ in der Splatting Image finde ich sehr wünschenswert. Wobei das ja nicht unbedingt ein Wunschtraum ist, im Grunde macht ihr ja bei den Hard Sensations gerade genau das. Und führt es oftmals noch ein ganzes Stück weiter – Kompliment dafür, was ihr da gerade aufbaut, das gehört mit zum schönsten, originellsten, sinnlichsten Filmjournalismus, den es derzeit in deutscher Sprache zu lesen gibt.
Bei Hard Sensations gibt es Rezensionen zu alten und neuen Pornofilmen. Obgleich das rein statistisch schon nicht der Fall ist, wird man immer wieder in unterschiedlichsten Situationen darauf angesprochen, einen „Porno-Blog“ zu machen. Oder halt sich bevorzugt im Schmutz zu wühlen. Ist dir diese selektive Wahrnehmnung auch bei dir aufgefallen? Bist du der Porno-Jochen?
Naja, eher im positiven Sinne: Man wird halt als eine Art Experte zum Thema betrachtet und deshalb immer wieder um Texte dazu gebeten. Ansonsten habe ich mich, denke ich, von Anfang an immer wieder zu so unterschiedlichen Filmen, Genres, Themen geäußert, dass es eher schwer ist, mich in so eine Schublade zu stecken. Wenn mich irgendwer trotzdem da reinstecken möchte, nur zu, der hat dann aber eher eine oberflächliche Perspektive auf mein Schreiben und ist dann dementsprechend vielleicht auch einfach selbst für mich als Gesprächspartner nicht so interessant.
Du sollst einen Sammelband betreuen, in dem das Gesamtwerk eines Regisseurs deiner Wahl gewürdigt wird. Wen wählst du und welcher Autor fällt dir sofort ein, der idealerweise mit an Bord sollte?
Schwierig. Es sollte natürlich ein Regisseur sein mit einem reichhaltigen Gesamtwerk, der aber reduziert, unterschätzt, vergessen und/oder missverstanden ist. Ich würde vermutlich Richard Lester wählen, den ich vor zwei, drei Jahren nach einer privaten Retrospektive seines (beinahe) Gesamtwerks als einen großen Humanisten des Kinos sehr lieben gelernt habe. Als Autoren würde ich zuallererst natürlich jene gegenwärtigen Kollegen wählen, die ich sehr schätze und mit denen ich stets gern Seite an Seite gedruckt werde: Silvia Szymanski, die ich in ihrer Originalität und (Vorurteils-)Freiheit für die vielleicht interessanteste Stimme in der aktuellen deutschen Filmkritik überhaupt halte. Sebastian Selig, der mir in seinem euphoristischen Gestus der unbedingten Liebe im Schreiben vielleicht momentan am nächsten ist. Lukas Foerster und Ekkehard Knörer, die mit ihrem Schreiben den Cinephilen in mir immer wieder inspiriert und neugieriger gemacht haben. Oliver Nöding, der in einem anderen Gestus schreibt als ich, aber dessen Liebe zum Bewegungskino und dessen leicht zu reizende Neugier und Leidenschaft für Unbekanntes nicht fehlen darf. Ich selbst würde mir nicht nehmen lassen, über einen der bis heute schönsten und intelligentesten und menschlichsten Superheldenfilme überhaupt zu schreiben: den sträflich unterbewerteten Superman III – den wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit einzigen Superman-Film, der nicht in den kosmischen Weiten beginnt, sondern in einer Schlange vor dem Arbeitsamt von Metropolis. Ein kleiner, wunderschöner Moment, in dem der ganze Humanismus Lesters zum Ausdruck kommt. Der diesen großartigen Film, d’accord mit dem Kinopublikum dieser Welt, nichtmal selbst mochte, aber wie es gelegentlich vorkommt, überragt das Werk dann eben hier die Wahrnehmung seines Schöpfers selbst. Für einen kleinen Sprengsatz am Rande bräuchte es ein zersetzendes Element wie Armond White. Und die Liebe eines Dominik Graf hätte ich auch gern dabei. Schlussendlich, um mal jemand von ganz außerhalb der usual suspects ins Boot zu holen: Mich würde interessieren, was eigentlich Christian Kracht dazu zu sagen hätte.
Falls du keinen Porno-Regisseur gewählt hast bekommst du als ausgewiesener Experte nochmal explizit die gleiche Frage mit diesem neuen Fokus gestellt.
Hm, in diesem Falle würde ich vielleicht dazu neigen, den Fokus ein Stück weit weg vom Auteurismus zu bewegen: Mich würde interessieren, in einem Sammelband mal die Porno-Debüts später bedeutender Nichtpornoregisseure zu betrachten. „9 Lives of a Wet Pussy“ von Abel Ferrara. Das Meisterwerk „The Fireworks Woman“ von Wes Craven. Undsoweiter. Das wäre sicher ein interessanter Steinbruch, in dem es noch so manches zu entdecken gibt.
Das Pornfilmfestival macht keinen Halt vor extremen Darstellungsformen. Fetische verschiedenster Art finden ebenso Platz wie queere oder Trans-Produktionen. Knüpfst du eigene Vorlieben an die Auswahl, wenn du einen Porno einlegst? Oder sind alle Filme gleich berechtigt und somit auch alle Pornofilme?
Das sind vielleicht eher zwei Ebenen, die parallel ablaufen bei der Sichtung. Natürlich kann man die eigene Sexualität nie völlig ausblenden, aber wenn sie letztlich das entscheidende Kriterium ist für die Auswahl, dann macht man etwas falsch. (Das gilt im Übrigen, wie ich finde, auch für nichtpornografische Filmfestivals: der Versuch, ein Festival nur mit Filmen zu machen, die einem persönlich gefallen, scheint mir etwas kurz gegriffen.) Ich habe durch das Pornfilmfestival erfahren und gelernt, dass eben nicht alle Pornografie so stumpf und öde ist, wie das, was man im Videothekenregal findet, und somit stoße ich auch immer wieder auf Filme, die ich persönlich heiß finde – da ist es übrigens ganz egal, ob die nun hetero, homo, queer, trans oder sonstwas sind, da kommt es eher auf die Intensität des Szenarios und der Begegnungen an als um die Geschlechter, Gender oder Sexualitäten, die dort miteinander interagieren. Ich würde vielleicht den Umstand, dass ich selbst einen Film sexy finde, als Indiz betrachten, dass da irgendetwas Interessantes, Reizvolles ist, aber das ist dann eher Ansatzpunkt für die Entscheidung, ob der dann auch zeigenswert ist. Wir sichten die Filme ja zu fünft, und wenn niemand von uns etwas Interessantes entdeckt, fliegt der Film raus. Wenn einer oder eine oder mehrere unterschiedliche Positionen jenseits der Gleichgültigkeit entwickeln, dann kommt er in die weitere Diskussion. (Und umgekehrt funktioniert das auf gar keinen Fall: Wenn ein Film mir persönlich nichts sagt, heißt das nicht automatisch, dass er keinen Platz im Festivalprogramm verdient – wir arbeiten recht gut im Kollektiv und mit teilweise diametralen ästhetischen Ansätzen zusammen, und nur so kann das vielfältige Programm entstehen, das wir machen. Es landen immer wieder Filme im Festivalprogramm, die ich persönlich entsetzlich finde, und allen anderen geht es genauso. Aber das ist wichtig, um ein breites Spektrum und einen Diskussionsraum zu eröffnen und unterschiedlichsten Interessen am Gegenstand Porno Raum zu schaffen.
Du wohnst in der gleichen Stadt wie zahlreiche weitere Filmschreiber auf meiner Liste möglicher oder bereits befragter Gesprächspartner. Ist Berlin 2014 das deutsche Mekka für Filmfans? Oder einfach ein kleineres Übel als die Provinz? Und überträgt sich die Ballung von Kollegen auch auf sozialer Ebene bzw hat sich sowas wie eine Berliner Clique von Filmkritikern gegründet? Man stößt sicher auch in einer Millionenstadt in der „Szene“ schnell auf bekannte Gesichter.
Zuerst mal: ich habe eine Liebesbeziehung zu Berlin, seit ich vor 14 Jahren aus der norddeutschen Provinz hergezogen bin. Als ein Übel, klein oder groß, betrachte ich die Stadt also sicher nicht, und in Sachen Kinokultur ist sie sicher schon der zentrale Ort, an dem man in Deutschland sein kann. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, anderswo zu leben, aber bei weitem nicht der einzige. Und zur Cliquenbildung: ja, natürlich ist das so. Man trifft eben auch in Berlin, bei den interessanten und relevanten Vorführungen, Retrospektiven und Filmreihen, immer wieder dieselben Cinemenschen, kommt ins Gespräch. Macht dann auch Projekte zusammen. Ich möchte das generell nicht missen. Das war noch stärker, als ich noch regelmäßig Pressevorführungen besucht habe, die dann wirklich oft wie eine Art Klassentreffen waren. Das fällt nun größtenteils weg, seit ich einen regulären 10-to-6-Dayjob habe. Aber trotzdem, man trifft sich abends im Arsenal, im Zeughaus oder auf einem der zahllosen Festivals der Stadt. Andererseits ist das nun durch soziale Netzwerke wie Facebook auch sehr stark aufgebrochen, und ich genieße es sehr, dass man nicht mehr zwingend in der gleichen Stadt leben muss, um in regelmäßigem, (all-)täglichem Austausch zu sein. Der Draht zum in Nürnberg residierenden Hofbauer-Kommando und der sich aus ganz Deutschland zu den Hofbauer-Kongressen zusammenfindenden Cinephilen etwa ist inzwischen nicht unbedingt weniger intensiv als der zum Berliner Filmkritikerzirkel.
Wenn du einen Film ganz groß besprechen solltest, unlimitiert in Umfang und Form und mit so sattem Gehalt, dass du beliebig lang dran schreiben kannst. Die Liebe (oder auch den Hass?) zu welchem Film würdest du dich am liebsten exegetisch auslassen?
Hass interessiert mich nicht so, das fällt also weg. Auch wenn ich als Randnotiz gern anmerke, dass der Film, den ich am innigsten hasse und der mir geradezu körperliche Schmerzen bereitet, Der Himmel über Berlin von Wim Wenders ist. Wenn ich mich für einen allerliebsten Film entscheiden müsste – was ich selbstredend nie tun würde –, dann käme Antonionis L’Eclisse in die ganz enge Auswahl, aber über den ist schon genug Richtiges und genug Falsches geschrieben worden. Wahrscheinlich würde ich doch irgendeinen Steven-Seagal-Film wählen. Oder Saw V.
Wie wichtig ist die das Kinoerlebnis in Relation zur Filmliebe an sich? Und wie sehr interessieren dich Materialfragen? Betrübt dich der anstehende Wegfall von 35mm-Kopien sehr und wie beurteilst du die Verantwortlichkeit der Inhaber, die im Begriff sind, unzählige Kopien zu vernichten?
Sehr, sehr wichtig. Bei aller Liebe, die ich kenntnisreich kuratierten und technisch gut aufbereiteten BluRay- und DVD-Editionen entgegenbringe, ist mir das Kino immer ein überlebenswichtiger Ort geblieben. Der dunkle Raum, die riesige Leinwand, in die ich am liebsten hineinkriechen und mit der ich mich zudecken möchte – ich sitze im Kino immer ganz vorne. Das Herausgenommensein aus Raum und Zeit, einfach nur allein zu sein mit dem Film im Dunkel, in der Gewissheit, dass es jetzt nichts Besseres, nichts Passenderes, nichts Anderes zu tun gibt als still zu sitzen und nach vorn zu sehen. Wenn man in Berlin regelmäßig ins Kino geht, begegnet man allerdings durchaus nicht nur den oben genannten Menschen, die durch die gemeinsame Leidenschaft mit einem verbunden sind. Sondern man sieht auch immer wieder, wie der Eskapismus des Kinos isolieren kann – es ist mitunter bemerkenswert, auf wie viele komplett soziophobe Cinephile man in den vorderen Reihen des Arsenal immer wieder trifft. Ich hoffe und glaube, nicht einer von ihnen zu sein und zu werden, dafür zieht mich zu viel immer wieder aus dem Kino heraus und ins echte Leben. Andererseits ist es natürlich immer ein beruhigender Rückhalt: das Kino wird immer da sein, auch wenn man alles andere vielleicht mal nicht auf die Reihe kriegt.
Hast du ein Lieblingsfilmland? Vielleicht eine Nation, die dich durch ihre Kinokultur so eingenommen hat, dass du hingereist bist oder sich eine vertiefende Beschäftigung auf anderer Ebene ergeben hat?
Eigentlich nicht, nein, beziehungsweise: das verlagert sich, wie das Weltkino eben auch, immer wieder aufs Neue. Ich bin mit Hollywood aufgewachsen, wie wir alle, den Aufbruch ins Weltkino hat dann mein erwachendes Interesse am Hongkong-Kino in den Teenagerjahren eingeleitet. Daraus erwuchs eine langjährige Faszination für das asiatische Kino, die koreanische New Wave hat mich sehr geprägt und lang begleitet. Das Interesse daran ist inzwischen ein wenig erloschen, weil sich eine Art generischer Mainstream herausgebildet hat, die Liebe zum japanischen Kino ist hingegen eine Konstante. Die Philippinen fand ich als Filmland zuletzt sehr spannend, Lav Diaz, Raya Martin, die üblichen Verdächtigen. Ansonsten dann doch wieder Amerika, wieder Hollywood, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Das amerikanisch-osteuropäische neue (DTV-)B-Picture. Die deutsche Kinogeschichte, gesehen durch die Augen der Hofbauer-Kommandanten. Ach, der Reichtum ist einfach zu groß, als dass ich mich entscheiden könnte. Für nächstes Jahr plane ich eine Reise nach Los Angeles, wo ich zuletzt mit 17 Jahren, zur Hälfte meines bisherigen Lebens also, war. Dort werde ich, wenn alles klappt wie angedacht, im Gästezimmer des großen Regisseurs Monte Hellman, das dieser über airbnb vermietet, logieren und vom Mulholland Drive aus einen Urlaub verbringen, der sich den Träumen, nicht der Realität der Stadt nähern soll.
Machst du es dir manchmal zur „Aufgabe“, gewisse Filme zu sichten? Filmgeschichte aufholen und nachvollziehen, Genres, Regisseure oder Strömungen gezielt zu erschließen? Oder lässt du solche Systeme privat ganz sein und schaust dann ausschließlich nach Lust, Laune und Geschmack?
Saya selalu mengambil proyek seperti ini, saya cenderung ingin tahu tentang pekerjaan yang lengkap dan pengembangan konteks yang lebih besar, tetapi harus diakui saya tidak sedisiplin rekan saya yang terhormat, Oliver Nöding. Rasa ingin tahu saya terlalu besar, saya terus tersandung di tengah jalan ( atau setengah jalan) ke hal-hal lain yang menurut saya sama menariknya, dan kemudian saya melompat dengan semangat yang sama, di sana. Keahlian bukanlah situs konstruksi saya, saya selalu tertarik pada terlalu banyak hal pada waktu yang bersamaan. Dan maka kehidupan nyata selalu menghalangi.


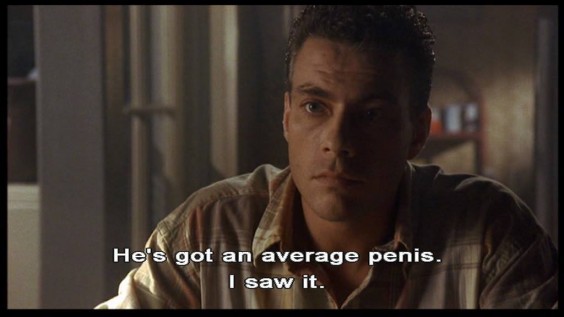



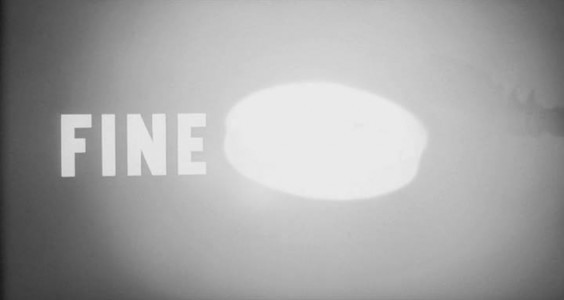




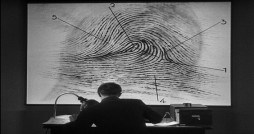
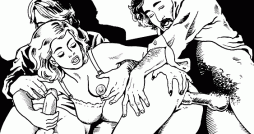
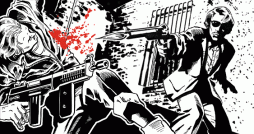

2 Kommentare zu "reden über schreiben über film(e): #8 Jochen Werner"
Trackbacks für diesen Artikel