Filmtagebuch einer 13-Jährigen #21: Il Cinema Ritrovato 2017
Von Silvia Szymanski // 24. Oktober 2018 // Tagged: Abenteurer, Augusto Genina, featured, Flapper, Grenzländer, Heilige, Helmut Käutner, Krieg, Malermodelle, Maria Orska, Mary Nolan, O. W. Fischer, Robert Mitchum, Seltsame Frauen, Vagabundinnen, Vergewaltigung // 1 Kommentar

Il Cinema Ritrovato, 24. Juni – 2. Juli 2017, Bologna
Bologna riecht schön. Nach Schweiß und Öl und heißen Steinen, Oleander und Gebäck, Früchten und Kaffee. Ein sanfter, alter Duft, wie aus der Kindheit, vermischt mit Hafen, Süden. Es wirkt selbst wochentags sonntäglich und entspannt. Ockerfarbene Arkaden. Freundliche Leute, oft jung, ein bisschen hippie, bisschen hip, spielerisch modisch gekleidet, schöne Augen.
Meine Lieblinge unter den Specials dieses Festivals waren die Reihen über Robert Mitchum (kuratiert von Bernhard Eisenschitz und Philippe Garnier), Helmut Käutner (kuratiert von Olaf Möller) und Augusto Genina (kuratiert von Emiliano Morreale). Filme mit Mary Nolan. Und ein kleiner Stummfilm mit Maria Orska.
Unter den Brücken (Helmut Käutner, 1945-1949) Man sagt, Carl Raddatz sei für das deutsche Kino seiner Zeit ein außergewöhnlich körperlicher, sinnlicher Darsteller gewesen, und Kristina Söderbaum schwärmt von ihm in ihren Memoiren. Aber ich kann mir nicht helfen: Gustav Knuth! Sein weiches, welpenhaftes Boxergesicht, die schweren Arme, bärenhafte Tapsigkeit, facettenreiche Mimik… Willy (Gustav Knuth) und Hendrik (Carl Raddatz) sind Freunde und teilen sich als Flussmatrosen einen knarrenden, alten Kahn. Anfangs störte mich ihre Einstellung zu Frauen: sie seien durchtriebene Vampire, die naive Matrosen ausnehmen. Das harte Urteil trifft z. B. eine zärtliche, junge Frau, die sich Hendriks Namen nicht merken kann, und ein kokettes Tanzmädchen, das unbekümmert mit Verehrern spielt und sich für niemanden entscheiden kann. Dann aber verlieben sich Hendrik und Willy in Anna (Hannelore Schroth) und werden menschlicher und sympathischer. Anna ist eine treue, empfindsame Reibekuchenbäckerin und Feierabendschneiderin und hat mal nackt einem Künstler, in den sie verliebt war, Modell gestanden. Als die Freunde das hören, gehen sie zum ersten Mal in ihrem Leben ins Museum. Verschämt fasziniert bestaunen sie die Aktgemälde. Nett fand ich es schon auch, wie Hendrik für Anna, als sie Angst vor den Nachtgeräuschen auf dem Boot hat, diese Klänge, die er liebt, imitiert  und erklärt. Süß auch, dass er seinem Hund unnütze Kunststücke beibringt wie den eigenen Schwanz zu jagen. Ein einfallsreicher, liebevoller Film; die Freunde, die ihn mir empfahlen, hatten Recht. 8/10
und erklärt. Süß auch, dass er seinem Hund unnütze Kunststücke beibringt wie den eigenen Schwanz zu jagen. Ein einfallsreicher, liebevoller Film; die Freunde, die ihn mir empfahlen, hatten Recht. 8/10
*
Über „Unter den Brücken“ schrieb auch Udo Rotenberg bei „Grün ist die Heide“.
„Jetzt geh ich endlich shoppen in der Stadt!“, hörte ich eine Festivalbesucherin sagen, als der Film zu Ende war, „das habe ich schon die ganze Zeit gewollt. Ich hab jetzt lang genug Matrosen ausgenommen!“
 Blood on the moon (Robert Wise, 1948) + Bandido! (Richard Fleischer, 1956) Die Plakatierer haben Robert Mitchums Bild mit den schwerlidrigen Leguanaugen überall in die Stadt aufgehängt. Es ist, als drehe sich Bologna hauptsächlich um ihn und dieses Festival; das macht mich stolz, dabei zu sein.
Blood on the moon (Robert Wise, 1948) + Bandido! (Richard Fleischer, 1956) Die Plakatierer haben Robert Mitchums Bild mit den schwerlidrigen Leguanaugen überall in die Stadt aufgehängt. Es ist, als drehe sich Bologna hauptsächlich um ihn und dieses Festival; das macht mich stolz, dabei zu sein.
Ich mag Mitchum sehr. Er ist ein cooler Typ, auch mit seiner Calypso-Platte. Vielschichtig und rätselhaft; man kann ihn nicht zu Ende anschauen. In seiner anstrengungslosen, autonomen Integrität, der unzynischen Desillusioniertheit und der Eigenart, sich vor jeder Aktion erst leise seufzend einen Ruck zu geben, weil das einen Schritt aus seiner eigenen Welt heraus bedeutet, erinnert er mich an meinen Vater. Auch in der Art, wie er sich dann in der allgemeinen Welt bewegt. Mitchum scheint immer erschöpft und schwer und sachte schwankend, als wäre er um ein riskantes Fließgleichgewicht bemüht, über dessen Gelingen er sich immer wieder wundert. Den Leguan hab ich schon erwähnt, aber ich denke auch an das Faultier. Oder an einen Koalabär, der sich von einer einzigen, ätherisch ölhaltigen Pflanze ernährt, so dass er immer bekifft ist und sein Fell nach Eukalyptus riecht.  Ein Freund erzählte mir, Mitchum habe wirklich viel gekifft; sein Ungleichgewicht könne aber auch davon kommen, dass er den Bauch so einzieht. Mitchum selber hat dazu gesagt: „People think I have an interesting walk. Hell, I’m just trying to hold my gut in“.
Ein Freund erzählte mir, Mitchum habe wirklich viel gekifft; sein Ungleichgewicht könne aber auch davon kommen, dass er den Bauch so einzieht. Mitchum selber hat dazu gesagt: „People think I have an interesting walk. Hell, I’m just trying to hold my gut in“.
Das muss man auch. Wenn etwas explodiert oder jemand auf ihn schießt und Mitchum sich verstecken muss, tut er das behutsam und verzögert, sanft, weich, vorsichtig, fast feig und wie auf Zehenspitzen. Man meint, er hätte wohl im echten Leben schwerlich damit überleben können. Aber wer weiß! Die Väter und Onkels meiner Generation erzählten von gewissen Kriegskameraden, die sich unglaublich achtlos benahmen. Alle um sie herum starben wie die Fliegen, nur ihnen passierte nichts. Vielleicht gerieten sie, weil sie, wie Mitchum oder Papa, immer einen Gedanken zu langsam waren, nicht richtig rein in die Geschehnisse, sondern wankten parallel daneben.
In „Bandido!“ kommt Mitchum als ewig durchreisender, müder Schieber und Drifter in ein ebenso müdes Kaff in Mexiko. Auf dem Platz vor dem Balkon seiner verwitterten Absteige ist eine Schießerei im Gange. Es ist gerade Revolution, 1916. Aus einem soeben von den Revolutionären zusammengeschossenen Schnapsbüdchen hat er sich auf seine berühmte, motorisch retardierte Art eine Flasche Schnaps stibitzen können. Nun greift er sich aus seiner Reisetasche einige der mitgebrachten handlichen Handgranaten, geht, beiläufig, Bauch eingezogen, auf dem Balkon in Deckung und wirft die Eier schlachtentscheidend ins Getümmel. Die Antwort trifft die wertvolle Flasche, aber er kann mit einer schlafwandlerisch sicheren Tai-Chi-Bewegung einen Schnapsrest aus den Scherben retten.
Was Mitchum auf der Welt auch wirklich sehr gut kann: Einen Typ beim Kragen packen und ihm eine geben. Das sieht auf einmal total entschlossen aus, authentisch, knapp, mit konzentrierter und genau dosierter Kraft.
Zu Frauen ist er würdevoll und nett; er versteht sie gut. Das, was an Liebe und Begehren ihm und anderen lästig werden könnte, behält er in sich. In „Bandido!“ ist sein Mädchen die unergründliche, stolze, taffe, unantastbar elegant gekleidete, mit einem anderen verheiratete Ursula Thiess. „Du weißt, was man mit entlaufenen Sklavinnen macht?“ erfindet er einen Grund, sie zu küssen.
In „Blood on the moon“ ist sein Mädchen Barbara Bel Geddes, die spätere Miss Ellie in „Dallas“. Sie besteht darauf, mit ihm zu kommen. Zunächst nicht wegen Liebe – sie ist ein burschikoses, anständiges Cowgirl –  sondern um sich an der Räubersuche zu beteiligen. Er ist dagegen, und, um sie zu schocken und zu stoppen, küsst er sie kurzerhand: „You want more of this or you have to go“, droht er ihr unfreundlich – sie bleibt, natürlich. Frauen!
sondern um sich an der Räubersuche zu beteiligen. Er ist dagegen, und, um sie zu schocken und zu stoppen, küsst er sie kurzerhand: „You want more of this or you have to go“, droht er ihr unfreundlich – sie bleibt, natürlich. Frauen!
*
*
Oft verlieben sich liierte Frauen in Mitchum, weil sie von ihren Männern enttäuscht sind. In „River of no return“ (auch Teil des Mitchum Specials; diesmal verpasst, aber: 9/10) gehört Marilyn Monroe anfangs einem jungen, windigen Egoisten. In „Bandido!“ ist Ursula Thiess die Frau des Waffenhändlers Mr. Kennedy. Kennedy hat die geldgierige, verletzende Unart, sie als Pfand bei riskanten Geschäften mit anderen unsensiblen Männern einzusetzen. Auch für Mitchum ist sie anfangs nicht die Hauptsache. An der Seite des kernigen Rebellenführers und Revolverhelden Escobar (Gilbert Roland) kämpft er stattdessen in der brennenden Sonne vor der schäumenden Brandung des wunderschönen Meeres bei Acapulco/Mexiko gegen die Unterdrücker. Eine spektakuläre Szene mit einem extra dicken Maschinengeschütz und einem Container voller Benzin und Dynamit besiegelt ihre Freundschaft. Dann verabschiedet sich Mitchum – „Ich hab noch etwas in einer Pfandleihe, das ich abholen will“ – und reitet stolz und frei entlang der sandigen Küste zu Mrs. Kennedy, die auf ihn wartet. 9/10
Bei Richard Fleischer, Regisseur von „Bandido!“, fielen mir auch schon bei „The New Centurions“ die authentisch rockigen, nie „gemacht“ wirkenden Locations auf. Die Schauspieler agieren darin scheinbar frei, wie ihrer eigenen Art gemäß; die Kamera scheint alles eher einzufangen, als es wo hinzustellen.
 The wonderful country/Heiße Grenze (Robert Parrish, 1959) Mitchums Pferd Lacrima scheut vor einer Steppenhexe, Mitchum fällt, verletzt sich und muss liegen – so beginnt der Film, so geht es immer weiter. Sein Leben ist ein erschöpftes Hin- und Herlavieren. Ein Geschobenwerden, Fallen, Aufrappeln und sich aus dem Staub machen zwischen verschiedenen feindlichen und rivalisierenden Lagern im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko (gedreht wurde in Durango bei New Mexiko). Er ist Bote, Lieferant und Schieber für wechselnde Herrschaften. Immer wieder muss er seufzend durch den Grenzfluss waten (eine merkwürdige Gemeinsamkeit mit Eva in Käutners „Himmel ohne Sterne“, später). Überall muss er sich anpassen und ummodeln lassen. Apathisch lässt er sich zum Wechseln seiner Anziehsachen und Zugehörigkeiten zwingen und besteht nur darauf, seinen speckigen Sombrero auf dem Kopf zu behalten.
The wonderful country/Heiße Grenze (Robert Parrish, 1959) Mitchums Pferd Lacrima scheut vor einer Steppenhexe, Mitchum fällt, verletzt sich und muss liegen – so beginnt der Film, so geht es immer weiter. Sein Leben ist ein erschöpftes Hin- und Herlavieren. Ein Geschobenwerden, Fallen, Aufrappeln und sich aus dem Staub machen zwischen verschiedenen feindlichen und rivalisierenden Lagern im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko (gedreht wurde in Durango bei New Mexiko). Er ist Bote, Lieferant und Schieber für wechselnde Herrschaften. Immer wieder muss er seufzend durch den Grenzfluss waten (eine merkwürdige Gemeinsamkeit mit Eva in Käutners „Himmel ohne Sterne“, später). Überall muss er sich anpassen und ummodeln lassen. Apathisch lässt er sich zum Wechseln seiner Anziehsachen und Zugehörigkeiten zwingen und besteht nur darauf, seinen speckigen Sombrero auf dem Kopf zu behalten.
Sechsundzwanzig Tage ging es wunderbar auch ohne, doch nun zwingen ihn seine „Retter“, sich zu waschen. Mitchum protestiert, dann fügt er sich. Besonders in Western kommen solche Szenen mit Waschrebellen manchmal vor; ich freue mich jedes Mal.
Waffenhändler, Waffenkunden. Jeder seiner Herren beider Seiten erzählt, bewertet und interpretiert dieselbe Geschichte anders, je nach Perspektive, je nach Eigennutz. Jeder hat auf seine Weise Unrecht. Es ist unwahrscheinlich, hier auf Menschlichkeit und Güte zu stoßen, aber ein Arzt behandelt Mitchum monatelang gratis, und der naive Ludwig aus Kassel muss sterben, weil seine enthusiastische Sympathie für Mitchum jemanden provoziert. Einmal wird Mitchum von einem Mexikaner und seinen fast erwachsenen Kindern gepflegt. Sie schlagen ihm vor, zu bleiben, da kommt schon wieder Krieg. Die Indianer, mit denen sie zwanzig Jahre friedlich zusammen lebten, haben sich aufhetzen lassen.
Mitchums Gesicht ist in dem Film berührend und machtlos schön. Mit diesem Mann darf man nicht spielen, denkt man; er ist eine alte Seele, ein tiefgründiges Kind. Julie London – große Augen, seltsames, beschwörendes Gesicht – macht ihm den Hof. Man erzählt sich, dass sie mit jedem schon geschlafen hat außer mit dem Laternenpfahl. Zumindest hab ich das so verstanden, aber zuhause beim zweiten Schauen, in deutscher Synchro, hieß es: mit dem ganzen Regiment hat sie geschlafen, ihr Mann ist blind wie eine Fahnenstange. (Ich glaube lieber meiner Interpretation). Sie liebt ihren Mann nicht, und als er tot ist, machen ihr und Mitchum Schuldgefühle arg zu schaffen, auch wenn sie nichts für seinen Tod und ihre Liebe können. Ein schöner, langer, eigenwilliger, windungs- und begegnungsreicher Pfad von einem Film. 9/10
![]() Cielo sulla palude (Augusto Genina, 1949). Ich freue mich wie als Kind, wenn ich die „Titanus“-Fanfare an Filmanfängen höre.
Cielo sulla palude (Augusto Genina, 1949). Ich freue mich wie als Kind, wenn ich die „Titanus“-Fanfare an Filmanfängen höre.
*
 Von „Cielo sulla palude“ hatte ich schon einige Monate zuvor gelesen; er kam wie gerufen. Ich hatte für einen möglichen Western recherchiert, an dessen Treatment ich mitschrieb. Es ging um Religion, Aberglauben, Vergewaltigung, ein junges Mädchen, und ich stieß auf die Legenden der Heiligen Agnes und der Heiligen Maria Goretti. „Cielo sulla palude“ handelt von Maria Goretti. Sie lebte nur kurze Zeit, von 1890 bis 1902.
Von „Cielo sulla palude“ hatte ich schon einige Monate zuvor gelesen; er kam wie gerufen. Ich hatte für einen möglichen Western recherchiert, an dessen Treatment ich mitschrieb. Es ging um Religion, Aberglauben, Vergewaltigung, ein junges Mädchen, und ich stieß auf die Legenden der Heiligen Agnes und der Heiligen Maria Goretti. „Cielo sulla palude“ handelt von Maria Goretti. Sie lebte nur kurze Zeit, von 1890 bis 1902.
Geninas Film spielt in ihrem Wohnort bei den Sümpfen von Nettuno, in der Nähe von Rom. Eine magisch leere Armeleutegegend, echt, aufdringlich körperlich. Unsichtbare Dämonen liegen wie Warane herum und verbeißen sich in den Seelen der Leute. Die Leute leben wie in Trance und hängen ihren dunklen oder heiligen Gefühlen nach. Manche können sich nicht mehr beherrschen. Und andere können sich nicht mehr beschützen. Sie sind dann wie gelähmt, wie Lämmchen, wenn der Wolf sie will.
Maria ist ein liebes, armes Mädchen. Sie ist die Älteste ihrer süßen, putzig vorlauten kleinen Geschwister und beseelt von ihrem Glauben an die Bibel. Die anderen glauben auch, aber nur halb. Ihr lieber Vater z. B. glaubt vor allem einer Kartenlegerin auf dem Jahrmarkt. Die Jahrmarktszene ist sehr schön – semidokumentarisch, von entspannter Ernsthaftigkeit. Man taucht ein in die dichte, reiche, abergläubische Volkskultur der Region. Eine Kuh hat Angst, weil sie ein Brandzeichen bekommen soll. Sie tut Maria schrecklich Leid.
 Als der Vater an Malaria erkrankt, behandelt ihn ein netter, besorgter Arzt gratis (wie in „The wonderful country“), aber er stirbt. Marias Familie kommt an den Hof eines Großbauern. Der faunisch-bukolische Patron macht Marias strenger Mutter den Hof. Sein pubertierender Sohn, ein hübscher junger Rabauke wie aus einem Pasolinifilm, schließt mit Maria Freundschaft. Sie will gern einmal ans Meer, sagt sie schwärmerisch; er fährt mit ihr hin. Selig und begeistert schürzt sie ihre Röcke und watet hinein. Er sieht ihre nackten Schenkel, und es kommt etwas Dunkles, Fremdes über ihn, aus dem
Als der Vater an Malaria erkrankt, behandelt ihn ein netter, besorgter Arzt gratis (wie in „The wonderful country“), aber er stirbt. Marias Familie kommt an den Hof eines Großbauern. Der faunisch-bukolische Patron macht Marias strenger Mutter den Hof. Sein pubertierender Sohn, ein hübscher junger Rabauke wie aus einem Pasolinifilm, schließt mit Maria Freundschaft. Sie will gern einmal ans Meer, sagt sie schwärmerisch; er fährt mit ihr hin. Selig und begeistert schürzt sie ihre Röcke und watet hinein. Er sieht ihre nackten Schenkel, und es kommt etwas Dunkles, Fremdes über ihn, aus dem  Sand, dem Meer, der Brise. Eine fixe Idee, die ihn nicht loslässt.
Sand, dem Meer, der Brise. Eine fixe Idee, die ihn nicht loslässt.
„Er hat Schwierigkeiten mit seinem Körper“, erklärte mir meine Mutter Jungen, in denen Sexualität Unheilvolles anrichten kann. Auch der Film zeichnet Alessandro nicht als bösen Menschen, sondern als einen Jungen, der seiner Sexualität nicht Herr wird. Er trägt Maria seine Schwierigkeiten an und bettelt herzzerreißend darum, dass sie mit ihm schläft. Sie hört ihm zu, sanft, nicht entsetzt. Er beschäftigt sie. Sie ist nicht abgestoßen. Sie fragt herum, was andere zu dem Thema sagen. Sie will auf keinen Fall etwas tun, das Gott nicht gefallen würde.
Zum Kommunionsunterricht muss Maria lange durch einen von Licht und Schatten durchflirrten und verwirrten Wald, wie ein Kind aus der schönen TV-Reportageserie „Die gefährlichsten Schulwege der Welt“. „Maria durch ein Dornwald ging“ heißt ein altes Lied, und Genina lässt der Passage viel Raum.



Im Kommunionsunterricht fragt Maria ein älteres, erfahrenes Mädchen, wie das mit der Sexualität sei. Ja, das sei auf alle Fälle eine Sünde, sagt diese. Man komme ganz sicher in die Hölle, wenn man unkeusch ist; Gott will nicht, dass wir so sind. Dann kommt ihr Freund, sie springt mit ihm davon, um in Rom mit ihm zu sündigen. „Man kann ja beichten, Gott verzeiht es“, sagt sie fröhlich. Maria ist verwundert, sie mag die Freundin gerne, aber das ist ihr zu widersprüchlich.
 Sie sagt dem heißen Jungen zuhause nein. Doch Alessandro ist besessen und verrückt nach ihr, auf eine so furchtbar durcheinandere und falsche Weise, dass man sich fürchten muss. Er belagert sie und spinnt sie ein in seine Gegenwart; überall ist er, man kommt nicht dran vorbei; er ist der Sexualtrieb in Person. (Die sture Präsenz und Autorität dieses getriebenen Willens – es ist wie in Hans Heinz Königs „Rosen blühen auf dem Heidegrab“, Wolfgang Staudtes „Rose Bernd“, Brunello Rondis „Il Demonio“). Er will sie zwingen, aber es kommt immer etwas dazwischen, jemand von draußen ruft sie, stört… die heiße Sonne sieht viele von Allessandros vergeblichen, immer brutaleren Versuchen.
Sie sagt dem heißen Jungen zuhause nein. Doch Alessandro ist besessen und verrückt nach ihr, auf eine so furchtbar durcheinandere und falsche Weise, dass man sich fürchten muss. Er belagert sie und spinnt sie ein in seine Gegenwart; überall ist er, man kommt nicht dran vorbei; er ist der Sexualtrieb in Person. (Die sture Präsenz und Autorität dieses getriebenen Willens – es ist wie in Hans Heinz Königs „Rosen blühen auf dem Heidegrab“, Wolfgang Staudtes „Rose Bernd“, Brunello Rondis „Il Demonio“). Er will sie zwingen, aber es kommt immer etwas dazwischen, jemand von draußen ruft sie, stört… die heiße Sonne sieht viele von Allessandros vergeblichen, immer brutaleren Versuchen.
Er sagt, er werde sie töten, wenn er sie nicht haben kann. Maria, auch in der Hoffnung, ihn damit zur Besinnung zu bringen, sagt, sie will lieber sterben als diese Sünde zu begehen. Es hält ihn nicht auf. Im Gegenteil; was sein Schwanz nicht darf, erlaubt er nun seinem Messer. „Das darfst du nicht, Allessandro, weißt du nicht, dass man davon in die Hölle kommt?“, soll Maria Goretti gesagt haben (im Film ist es ein bisschen anders), und, im Sterben: „Sagt ihm, ich habe ihm verziehen. Hoffentlich verzeiht ihm auch der liebe Gott.“ (Der Legende nach tat es dem wahren Allessandro nachher schrecklich Leid, und er wurde ein frommer Mann). 9/10
 Maddalena (Augusto Genina, 1954). Ein freigeistiger Bonvivant erlaubt sich den jovialen Scherz, die Prostituierte Maddalena (Märta Torén) als Heilige Jungfrau für das Passionsspiel in seinem steppenheißen Heimatdorf einzuschmuggeln. Die Leute wissen nicht von ihrem eigentlichen Beruf, und Maddalena kommt, nach anfänglicher Skepsis, bei den Proben sehr gut an; das biblische Kostüm steht ihr fantastisch; sie sieht glaubwürdig entrückt aus. Sogar ein Kind gesundet in ihrer Gegenwart; die Leute im Dorf halten das für ein Wunder und verehren sie als Heilige. Maddalena spielt nicht wegen des Geldes mit. Sie tut es aus Verachtung. Sie sieht die Veranstaltung als Farce und will sie durch ihr Mitwirken entweihen. Sie glaubt nicht mehr an die gütige göttliche Zauberkraft, seit ihre kleine Tochter in einer Kirche verbrannt ist; ihr Kommunionsschleier hatte an einer Kerze Feuer gefangen; keine überirdische Macht hat das verhindert. Ihr Auftraggeber bedrängt Maddalena, ihrem eigentlichen Beruf gemäß für Geld mit ihm zu schlafen. Als sie sich weigert, gibt er, kindisch beleidigt, ihre Rotlichtidentität preis und unterschätzt dabei die Empörung der enttäuschten Dörfler darüber, dass sie die Prostituierte nicht nur gespielt hat. Ihr langer Lauf weg von der steinigenden Meute in diesem schönfarbigen Film. 8/10
Maddalena (Augusto Genina, 1954). Ein freigeistiger Bonvivant erlaubt sich den jovialen Scherz, die Prostituierte Maddalena (Märta Torén) als Heilige Jungfrau für das Passionsspiel in seinem steppenheißen Heimatdorf einzuschmuggeln. Die Leute wissen nicht von ihrem eigentlichen Beruf, und Maddalena kommt, nach anfänglicher Skepsis, bei den Proben sehr gut an; das biblische Kostüm steht ihr fantastisch; sie sieht glaubwürdig entrückt aus. Sogar ein Kind gesundet in ihrer Gegenwart; die Leute im Dorf halten das für ein Wunder und verehren sie als Heilige. Maddalena spielt nicht wegen des Geldes mit. Sie tut es aus Verachtung. Sie sieht die Veranstaltung als Farce und will sie durch ihr Mitwirken entweihen. Sie glaubt nicht mehr an die gütige göttliche Zauberkraft, seit ihre kleine Tochter in einer Kirche verbrannt ist; ihr Kommunionsschleier hatte an einer Kerze Feuer gefangen; keine überirdische Macht hat das verhindert. Ihr Auftraggeber bedrängt Maddalena, ihrem eigentlichen Beruf gemäß für Geld mit ihm zu schlafen. Als sie sich weigert, gibt er, kindisch beleidigt, ihre Rotlichtidentität preis und unterschätzt dabei die Empörung der enttäuschten Dörfler darüber, dass sie die Prostituierte nicht nur gespielt hat. Ihr langer Lauf weg von der steinigenden Meute in diesem schönfarbigen Film. 8/10
Mitternachtsliebe/Les Amours de Minuit (Marc Allegret, Augusto Genina, 1931). Marcel (Pierre Batcheff, der fast wie der junge James Stewart aussieht) ist auf der Flucht, weil er als Angestellter seiner Bank in die Kasse gegriffen hat.
In einem nächtlichen Eisenbahnabteil, dessen surreal geheimnisvolle Stimmung mich an Jess Francos „Miss Muerte“ erinnert, kommt er ins Gespräch mit einem älteren Reisenden. Sie gleiten rasend durch die Dunkelheit, eine fragile Kapsel der Geselligkeit im All. Der andere, ein erfahrener Gangster, erkennt das Greenhorn und stellt sich heimtückisch freundlich. Beide wollen am Morgen auf dasselbe Boot nach Übersee. „Lass uns die Nacht zusammen am Hafen durchmachen“, schlägt er mit Hintergedanken vor. Sie gehen zum wunderbar lebensechten, schmutzigen und rüschenweichen Can Can ins „Paradies“ Dort ist auch das Mädchen des Profis und ihre ergebene, süße Freundin. Sie singt ein freches Lied vor einem wild und aufregend zusammengewürfelten Publikum. Ich mag an diesem dichten, kleinen, dunklen Film seine Natürlichkeit und Körpernähe, das unerwartete Verhalten. 8,5/10
Bildnis einer Unbekannten (Helmut Käutner, 1954). Ruth Leuwerik spielt – ihrem Image zuwider und passend zum Filmthema Doppelleben – die ehemalige Nachtclubsängerin Nicole, die nun mit dem Diplomaten Walter verheiratet ist. Die unmenschlichen Regeln seiner eleganten, manierierten Gesellschaft zwingen beide zum Lügen und Heucheln. Seine Sexualität aber hat sein staatstragender Beruf nicht killen können; er findet Nicole und ihr Vorleben aufregend und prickelnd, nur darf es nicht rauskommen. Das findet auch Nicole. Liebende, weibliche Rücksichtnahme, mit großen, manchmal selbstmörderischen Opfern, begegnet mir oft in den Filmen dieses Festivals.
Ein Kollege kompromittiert Walter mit der Zurschaustellung eines Aktgemäldes, auf dem Nicole zu sehen ist. Nicole ist das nicht schuld; der Künstler Jan Maria (O. W. Fischer) hat sie bekleidet im Theater gesehen und sich das Ganze dann zusammenfantasiert.
Jan Maria ist ganz anders als die Leute in den Kreisen ihres Mannes. Er sagt alles brutal wahrheitsgemäß gerade heraus. Das wirkt besonders auf seine Freundinnen erschreckend gefühlsarm und egoistisch und verletzt sie. Aber er ist auch etwas Besonderes, in sich Kompliziertes.
O. W. Fischer hat eine kapriziöse, verrückte Art, zu schauspielern. Wie ein Zauberer. Er öffnet beiläufig, wie aus Versehen, Verstecke, wo andere alles zu machen. Ein einfallsreiches, freies, artistisches Improvisieren wie seines kenne ich von keinem anderen.
Er wirbt um Nicole. Sie ist amüsiert, aber sie liebt Walter, und sie sagt das auch: Dass sie sich stattdessen nun in Jan Maria verliebe, sei so unwahrscheinlich wie Schnee im August. Es ist August, und in der Nacht malt Jan Maria Kristalle an die Fenster und dekoriert die Fensterbänke mit falschem Schnee. Nicole ist gerührt, aber es ist unnütz, und das weiß er. Es sind nur Tricks, Vorspiegelungen. Wie seine Leichtlebigkeit, die Sunny-Boy Attitüde, die amoralische Freiheit und Courteoisie. In Wahrheit ist/war er selten glücklich: Das sagt Jan Maria im Film und Otto Wilhelm in seiner Autobiographie. 9/10
Ich lese gerade O. W. Fischers „Engelsknabe war ich keiner“. Ein schwebendes Buch. Als wäre alles durchsichtig; das Menschsein nichts als Rolle, Vortäuschung. Fischer fand, dass wir unter einer Art selbstgewählter Hypnose leben; wir blenden die multidimensionale Wucht von Allem aus, weil wir sie nicht ertragen können und – vielleicht zu Recht – befürchten, davon verrückt zu werden oder zu sterben. Und blenden aus, dass wir das ausblenden. Fischer war sich sicher, im früheren Leben eine kurz vor seiner Geburt verstorbene Prostituierte gewesen zu sein, die bei seiner Mutter um die Ecke wohnte und von der diese fasziniert gewesen sei.
Ludwig II. – Glanz und Elend eines Königs (Helmut Käutner, 1954). Eine tiefe, schreckliche Studie darüber, wie aus einem Leben, scheinbar ohne Notwendigkeit, eine Tragödie werden kann. Aus einem inneren Zwang entsteht Unheil aus den Leuten; einer wird dem anderen zum Verhängnis. Ludwig ist umgeben von einer großen Zahl ansehnlicher, interessanter, bis in die kleinen Nebenrollen wahnsinnig gut charakterisierter Männer: der egoistische Wagner (Paul Bildt), Bismarck (Friedrich Domin), Holnstein (Rolf Kutschera), Ludwigs Bruder Otto (Klaus Kinski), bestürzend kindlich, kriegstraumatisiert. Ruth Leuwerik als Elisabeth von Österreich: so verzweifelt aufgelöst, im traurigen Einklang mit dem Freund, die blaue, blaue Szene am See. Selbst Schloss Neuschwanstein wirkt wie eine komplexe, schicksalsträchtige Person. Es ist alles so überspannt, von selber, keiner will das. Es ist nicht auszuhalten. 10/10
O. W. Fischer spielt in beiden Filmen herzzerreißend intensiv. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass er sich damit entschuldigen will. Für irgendetwas Wesentliches, das er an sich nicht ändern kann. Wie auch der arme Ludwig, und wie Jan Maria. Das rührte mich so. Da merkte ich, dass ich ihn liebe.
Hier schreibt Udo Rotenberg über „Bildnis einer Unbekannten“ und hier Michael Kienzl.
 Home from the Hill (Vincente Minnelli, 1960). Überspannung, auch in diesem Film. Nur nicht in seiner Hauptfigur. Alle in seinem Umfeld passen auf, dass dieser Mann entspannt bleibt. Wade Hunnicutt (Robert Mitchum), Patriarch und Draufgänger, sitzt im Chefsessel in seinem Jagdzimmer. Jagdhunde, Jagdtrophäen. Er hat seinen Sohn Theron (George Hamilton) zu sich beordert. Theron ist ein introvertierter Schmetterlingsnerd und nervöses Hemd; Anthony Perkins hätte diese Rolle auch gut gestanden. Seine Mutter Hannah (Eleanor Parker) hält schon seit Jahren „ihre Tür vor ihrem Mann verschlossen“ und verzärtelt Theron: So jedenfalls sieht das Wade,
Home from the Hill (Vincente Minnelli, 1960). Überspannung, auch in diesem Film. Nur nicht in seiner Hauptfigur. Alle in seinem Umfeld passen auf, dass dieser Mann entspannt bleibt. Wade Hunnicutt (Robert Mitchum), Patriarch und Draufgänger, sitzt im Chefsessel in seinem Jagdzimmer. Jagdhunde, Jagdtrophäen. Er hat seinen Sohn Theron (George Hamilton) zu sich beordert. Theron ist ein introvertierter Schmetterlingsnerd und nervöses Hemd; Anthony Perkins hätte diese Rolle auch gut gestanden. Seine Mutter Hannah (Eleanor Parker) hält schon seit Jahren „ihre Tür vor ihrem Mann verschlossen“ und verzärtelt Theron: So jedenfalls sieht das Wade,  und der Film schaut lange aus Wades verächtlicher Perspektive auf alles Sensible, leicht Verletzliche, das an der Verweibchlichung der an sich männlichen, kraftvollen Welt schuld ist. Wade will, dass Theron endlich zum Mann abgerichtet wird. Sein junger Assistent Lafe (George Peppard) soll ihn anleiten und zum Jagen von Tieren und Mädchen tragen. Dann aber, ungewöhnlich spät, verlagert sich der Schwerpunkt. Lafe rückt in die Mitte. Perspektiven verschieben, Hintergründe offenbaren sich. Vergangenes Unrecht tritt zutage, lange hochgehaltene falsche Bilder, Werte, Lebenslügen werden revidiert. Kunstvoll entpuppt sich der Film aus seiner Raupe, wie Wades Schmetterlinge. Am Ende sind die Unterschätzten rehabilitiert und fangen neue Leben an. Ich war froh, dass sie nicht länger leiden müssen. 8/10
und der Film schaut lange aus Wades verächtlicher Perspektive auf alles Sensible, leicht Verletzliche, das an der Verweibchlichung der an sich männlichen, kraftvollen Welt schuld ist. Wade will, dass Theron endlich zum Mann abgerichtet wird. Sein junger Assistent Lafe (George Peppard) soll ihn anleiten und zum Jagen von Tieren und Mädchen tragen. Dann aber, ungewöhnlich spät, verlagert sich der Schwerpunkt. Lafe rückt in die Mitte. Perspektiven verschieben, Hintergründe offenbaren sich. Vergangenes Unrecht tritt zutage, lange hochgehaltene falsche Bilder, Werte, Lebenslügen werden revidiert. Kunstvoll entpuppt sich der Film aus seiner Raupe, wie Wades Schmetterlinge. Am Ende sind die Unterschätzten rehabilitiert und fangen neue Leben an. Ich war froh, dass sie nicht länger leiden müssen. 8/10
Himmel ohne Sterne (Helmut Käutner, 1955). Anders als in „Unter den Brücken“, bewegt sich Gustav Knuth hier schon in der Vaterrolle seiner späteren Filme. Er macht das gut, auch wenn ich dem sexuellen Mann nachtrauere. Gut geölt und geschmeidig agiert er als Kaufmann Otto hinter der Theke seines bayrischen Gemischtwarenladens. So waren die Kaufleute auch in den Läden meines kleinen Ortes in den Sechziger Jahren.
Sein Hausmädchen sagt ihm durchs Haustelefon, oben in seiner Wohnung warte seine Schwiegertochter Anna (Eva Kotthaus). Otto sagt, sie soll ihr einen Kaffee geben. „Aber schon den guten“, gibt er sich einen Ruck. Seine Frau und er verdrehen die Augen, dass Anna immer wieder angewackelt kommt, über die mancherorts noch (illegal) passierbare deutsch-deutsche Grenze. Annas kleiner Sohn wohnt bei ihnen. Sie sehen ihn schon ganz als ihren an. Annas Großeltern aber wohnen in Thüringen, und die junge Enkelin, Mutter und Witwe zerreißt sich zwischen Ost und West.
Immer wieder muss sie wie eine Rehmutter durchs Gestrüpp krabbeln, den sie jagenden Grenzsoldaten entgehen, einen Grenzfluss durchschwimmen. Es hat Poesie, wie sie das macht und wie der Film das zeigt. Der westdeutsche Zöllner Carl (Erik Schumann) erwischt sie und verrät sie nicht; er hilft ihr sogar bei der Entführung ihres Kindes in den Osten. Sein Freund Willi (sehr gut: Georg Thomalla) nimmt ihn mit in einem Versteck in seinem LKW. Unterwegs krabbelt der Kleine kurz vor der Grenze unbemerkt heraus, weil er beim Vorbeifahren ein Kinderkarussell gesehen hat. Carl sucht und findet ihn und bringt ihn ihr. So beginnt die Liebe.
Bilder: Udo Rotenberg in seinem Text über „Himmel ohne Sterne“
Das verwitternde Dorf in Thüringen, wo Anna mit ihren Großeltern wohnt und im dröhnenden Maschinenlärm einer nur oberflächlich strengen VEB-Fabrik arbeitet, liegt in einem romantischen, tiefen Tal am Fuße einer gewaltigen Eisenbahnbrücke; das Hammer und Sichel Emblem auf einem der Pfeiler wirkt in der Proportion genau so winzig wie die alte Kirche. Annas Söhnchen hat darauf bestanden, hier sein Cowboykostüm zu tragen; die Dorfkinder („Rothäute“ nennt sie jemand mit wohlwollendem Humor) foppen und bewundern ihn deswegen.
Annas Opa (Erich Ponto) ist ein mürrischer Lehrer alter Schule. Man merkt ihm den Beruf schon an, bevor man ihn weiß. Er spricht gewählt, in gelehrten Pointen; Liebe und Verständnis versteckt er eher. Annas Oma (Lucie Höflich) hat der Tod ihres Sohnes und der fast gesamten Familie bei den Luftangriffen auf Dresden aus der Bahn geworfen. Sie glaubt, dass er noch lebt, bzw. in Gestalt anderer Männer zurückkehrt. Weil es manchmal den Angehörigen verschwiegen wird, wenn jemand tot ist, denkt sie: „Vielleicht bin ich ja auch schon tot, aber mein Mann sagt es mir nicht.“
Sascha (Horst Buchholz), berührend schön und beinah stumm als russischer Besatzungssoldat, kommt manchmal zu Annas Opa Schach spielen. Ein Fremder aus einer sehr, sehr fernen Gegend, der sich auf Deutsch nur unbeholfen mitteilen kann und seine Verehrung und Liebe für Anna, seine ganze Persönlichkeit für sich behält. Sie bittet ihn, ihr einen Passierschein für sie und ihr Kind zu besorgen; sie möchte im Westen mit Carl und ihren Großeltern, die auch fliehen sollen, leben. Er verspricht es.
Doch Anna beschließt bei einer spontanen Gelegenheit, nicht auf den Passierschein zu warten, sondern mit Erik schon jetzt zu fliehen; ihr Kind kommt wieder in Willis LKW unter. Es sieht flüsternd, verschwiegen, traurig märchenhaft aus, wie Annas Großeltern ihr Haus in dieser unheilvollen Nacht verlassen, um sich in den Westen zu stehlen – viel mehr aus Vernunft und Enkelin und Urenkel zuliebe denn aus Neigung. Es fällt ihnen schwer, sich von dem lebenslangen Haus zu trennen und den Schlüssel in die Regentonne am Zaun zu werfen.
In der Nacht sieht Sascha Anna fliehen und ruft ihr auf Russisch, was sie nicht versteht, hinterher, er habe jetzt den Schein… ach, ich erzähle das nicht weiter.
Ich hab oft Pech mit Filmen vor politisch-zeitgeschichtlichem Hintergrund. Ich finde, sie verlieren oft zu viel von sich und ihrem Zauber, indem sie die Figuren zu Stellvertretern und Symbolen machen. Hier ist das aber anders. Alles geschieht in sehr individuellen Menschen. Ein lyrischer, unendlich sorgfältiger, dichter und facettenreicher Film. 9/10
Outside the Law (Tod Browning, 1930). Eine moderne, pragmatische Gangsterfrau (Mary Nolan), witzig und abgebrüht, will nicht heiraten, keine Haustiere haben, keine Kinder. Ihr in sie verliebter Gangstermann eigentlich schon. Er freundet sich trotzig mit einem einsamen, kleinen Nachbarjungen und seinen Hündchen an. Am Weihnachtsabend wird die arme, kühle Lady emotional überrumpelt. Nacheinander kommen, von ihrem Freund gelockt, in ihr Wohnzimmer: ein armer, kleiner Waisenjunge. Seine nette Hündin. Ein kleiner Welpe. Noch einer. Und noch einer. Noch einer. Sie will sie alle nicht. Da wackelt das letzte Hündchen herein. Es ist besonders süß und hässlich, und es bettelt um Liebe. Der Waisenjunge klettert auf ihren Schoß. Er legt seine dicken Ärmchen um ihren Hals. Geh weg, sagt sie. Da weint er bitterlich. Rührung, Niedlichkeit, Erbarmen übermannen sie. Das Leben hat sie weichgekocht. Sie ist verloren. (Einen längeren Text über „Outside the Law“ habe ich hier für critic.de geschrieben). 8/10
 Mary Nolan aus „Outside the law“ ist ein eigenartiger Typ. Ein mokantes, kunstseidenes Mädchen, platinblonder Schluck Wasser in der Kurve, attraktiv und windschief. Ihre hängenden Schultern, der geduckte Rücken geben ihr etwas Argwöhnisches, Rebellisches. Ihr betont schlampiger, achtloser, schlendernder Gang, ihr ironisches, kühles Lächeln… sie ist eines dieser flatterhaften, witzigen und unglückseligen Girls und Flappers, wie ich sie aus den Romanen von Jean Rhys und Irmgard Keun kenne. Auch ihre eigene Lebensgeschichte liest sich so. Sie war ein Waisenkind, Künstlermodell, Ziegfeldgirl und von ihrem 14. Lebensjahr an die Geliebte eines 24 Jahre älteren, verheirateten Mannes, des damals sehr erfolgreichen Comedians Frank Tinney. Tinney war aus Eifersucht gewalttätig zu ihr. Einmal zeigte sie ihn an – erfolglos; man hielt es für einen Publicitytrick; „a nonsensical mixture of fights and laughs“ charakterisierte sie später diese Beziehung.
Mary Nolan aus „Outside the law“ ist ein eigenartiger Typ. Ein mokantes, kunstseidenes Mädchen, platinblonder Schluck Wasser in der Kurve, attraktiv und windschief. Ihre hängenden Schultern, der geduckte Rücken geben ihr etwas Argwöhnisches, Rebellisches. Ihr betont schlampiger, achtloser, schlendernder Gang, ihr ironisches, kühles Lächeln… sie ist eines dieser flatterhaften, witzigen und unglückseligen Girls und Flappers, wie ich sie aus den Romanen von Jean Rhys und Irmgard Keun kenne. Auch ihre eigene Lebensgeschichte liest sich so. Sie war ein Waisenkind, Künstlermodell, Ziegfeldgirl und von ihrem 14. Lebensjahr an die Geliebte eines 24 Jahre älteren, verheirateten Mannes, des damals sehr erfolgreichen Comedians Frank Tinney. Tinney war aus Eifersucht gewalttätig zu ihr. Einmal zeigte sie ihn an – erfolglos; man hielt es für einen Publicitytrick; „a nonsensical mixture of fights and laughs“ charakterisierte sie später diese Beziehung.
In Young desire (Lewis D. Collins, 1930) läuft Mary Nolan als Artistin Helen weg von ihrer halbseidenen Existenz auf dem Rummelplatz und trifft auf der Landstraße Bobby (William Janney). Das süße, naive, männliche Landei ist ein reicher Sohn; seinem Daddy gehört praktisch ein ganzes Provinzstädtchen. Bobby steht sofort in Flammen. Er schwärmt ihr von dem neuen Rathaus vor, bei ihm zuhause, das sie unbedingt sehen müsse. Sie hebt amüsiert die Braue: „Ein neues Rathaus! Warum hast du das nicht gleich gesagt! DANN bleibe ich natürlich.“ Er merkt, dass sie Witze macht, aber er strahlt sie ungebrochen bewundernd an. Es ist wie mit dem Kind und den Welpen im vorigen Film. Sie sträubt sich, aber das Kindliche und Herzerfrischende nehmen Besitz von ihren Gefühlen. Sie lieben sich, sie spielt für Bobby Hausfrau, kocht ihm Stangensellerie. Seine Eltern sagen, sie sei schlecht für ihn, kompromittiere ihn mit ihrer Vergangenheit, mache ihn zum Gespött, zerstöre sein Leben. Wie in „Bildnis einer Unbekannten“, wird auch hier der Tingeltangelfrau ins Gewissen geredet. Sie trennt sich, geht zurück zur Kirmes. Hält den Schmerz nicht aus. Bei einer Heißluftballonnummer, bei der man sich aus großer Höhe fallen lässt, macht sie den Fallschirm nicht auf. Eine große, dunkel glühende, surreale Szene. Bobby wird mit zertrümmerter Seele von den Eltern heimgeführt, seiner von ihnen gelenkten Bestimmung entgegen. 9/10
 Nachdem Mary Nolan in den Zwanziger- bis Dreißigerjahren Hauptrollen in deutschen und amerikanischen Stumm- und Tonfilmen gespielt hatte, nahm das Pech in ihrem Leben überhand. Sie ging mit einem Modegeschäft Pleite, tingelte wenig erfolgreich auf Vaudeville-Bühnen durch die Provinz. Probleme mit Justiz und Polizei, Unterernährung, Drogen, Zusammenbrüche von Seele und Gesundheit. 1948 starb sie an einer Schlafmittelüberdosis.
Nachdem Mary Nolan in den Zwanziger- bis Dreißigerjahren Hauptrollen in deutschen und amerikanischen Stumm- und Tonfilmen gespielt hatte, nahm das Pech in ihrem Leben überhand. Sie ging mit einem Modegeschäft Pleite, tingelte wenig erfolgreich auf Vaudeville-Bühnen durch die Provinz. Probleme mit Justiz und Polizei, Unterernährung, Drogen, Zusammenbrüche von Seele und Gesundheit. 1948 starb sie an einer Schlafmittelüberdosis.
Ähnlich unglücklich verlief das Leben der Hauptdarstellerin eines Films, dessen Titel ich aus einer Künstlerbiographie kannte:
Die schwarze Loo (Max Mack, Louis Neher, 1917) Maria Orska war für ihr damaliges Publikum und ihre Künstlerfreunde ein erotisches Naturereignis. Auch heutzutage ist sie noch jemand, den man nicht leicht vergisst: eine rosenhafte, wilde, begeistert tanzende junge Frau, ein bisschen Südseemädchen, ein bisschen junge Hannelore Elsner. Orska hatte eine Liebe mit Oskar Kokoschka, und auch in diesem groschenheftchen-, küchenballadenhaften Film spielt sie die Freundin eines Künstlers, eine Vagabundin, die einen todkranken Komponisten liebt und inspiriert. „Du bist der einzige, der jemals gut zu mir war“, sagt sie dankbar. Immer wieder sieht man sie an seiner Haustür, fortgehend, um Geld zu verdienen, heimkommend mit Geld. Sie tanzt abends  in Wirtschaften. Nie umsonst, nur gegen Geld, da ist sie pragmatisch. Sie singt ihm selbsterfundene Tanzlieder vor, die er in seinem Werk verwendet. Ich mochte diesen schlichten, kleinen, stummen Film. 8/10.
in Wirtschaften. Nie umsonst, nur gegen Geld, da ist sie pragmatisch. Sie singt ihm selbsterfundene Tanzlieder vor, die er in seinem Werk verwendet. Ich mochte diesen schlichten, kleinen, stummen Film. 8/10.
Maria Orska, russisch-jüdischer Herkunft, Morphinistin, beging 1930 im Alter von vierzig Jahren Selbstmord mit einer Überdosis Veronal.
 Man kann sich schön ernähren in Bologna. Viele gute Sachen für das Innere des Bauchs und die vielen kleinen Tiere, die dort leben. Ziegenmilcheis, kalte, sahnige Mokkacreme, schönes, reifes Obst. In der Mittagspause essen wir oft eine Kleinigkeit in der nahen, kleinen Markthalle im Stadtzentrum. Einmal war ich spät dran und ging an den Hähnchenstand, vor dem keine Schlange wartete. Mir tun die Hühner Leid. Aber ich bin nicht konsequent. Mein Italienisch reichte nicht, um nach Details der Speisekarte zu fragen. Also sagte ich auf Englisch, ich möchte einfach irgendein Stück Hähnchen und ein paar Bratkartoffeln. Der Mann, der mir das Essen gab, war schön und wurde immer schöner, je länger ich ihm zusah. Gesammelt, gedrungen, sanft, würdevoll, respektvoll, weich-traurig, ein Mann in Moll. Mehr ein Fischer-Typ als Fleischer oder Koch. Auf der Karte standen nur Gerichte ab vier Euro, aber er wollte nur zwei Euro von mir, für ein Hähnchenbein und viele leckere Bratkartoffeln. Ich weiß nicht, warum er mir diesen absurden Sonderpreis machte. 10/10
Man kann sich schön ernähren in Bologna. Viele gute Sachen für das Innere des Bauchs und die vielen kleinen Tiere, die dort leben. Ziegenmilcheis, kalte, sahnige Mokkacreme, schönes, reifes Obst. In der Mittagspause essen wir oft eine Kleinigkeit in der nahen, kleinen Markthalle im Stadtzentrum. Einmal war ich spät dran und ging an den Hähnchenstand, vor dem keine Schlange wartete. Mir tun die Hühner Leid. Aber ich bin nicht konsequent. Mein Italienisch reichte nicht, um nach Details der Speisekarte zu fragen. Also sagte ich auf Englisch, ich möchte einfach irgendein Stück Hähnchen und ein paar Bratkartoffeln. Der Mann, der mir das Essen gab, war schön und wurde immer schöner, je länger ich ihm zusah. Gesammelt, gedrungen, sanft, würdevoll, respektvoll, weich-traurig, ein Mann in Moll. Mehr ein Fischer-Typ als Fleischer oder Koch. Auf der Karte standen nur Gerichte ab vier Euro, aber er wollte nur zwei Euro von mir, für ein Hähnchenbein und viele leckere Bratkartoffeln. Ich weiß nicht, warum er mir diesen absurden Sonderpreis machte. 10/10
Die vielen jungen Leute in Bologna sitzen bis in die Nacht auf den Plätzen, trinken Sachen aus den umliegenden Spätis oder kaufen ihr Bier von herumziehenden Verkäufern mit Eistaschen. Ein verrückter Mann lief herum und bellte böse. Die Leute machten ängstlich einen Bogen um ihn.
 In der „Macondo“ Bar bekamen wir von einem freundlichen Barkeeper beim ersten Mal viel zu große Schnäpse eingeschenkt: alten Grappa und italienischen Kräuterschnaps. Ein fernöstlicher Nippesverkäufer verfolgte mich beharrlich mit einem großen Beutel voller Unsinn. Schließlich kaufte ich ihm eine kleine weiße Hartplastiktaube ab, die leuchten, piepen und trillern kann. Als ich sie, wieder daheim, meinem Freund schenkte, erkannte ich, ich hätte dem Händler am besten einen ganzen Schlag dieser Tauben abgekauft. Ein geniales Geschenk für lustige, große Jungen. Sie wissen sofort, wohin man sie sich halten muss.
In der „Macondo“ Bar bekamen wir von einem freundlichen Barkeeper beim ersten Mal viel zu große Schnäpse eingeschenkt: alten Grappa und italienischen Kräuterschnaps. Ein fernöstlicher Nippesverkäufer verfolgte mich beharrlich mit einem großen Beutel voller Unsinn. Schließlich kaufte ich ihm eine kleine weiße Hartplastiktaube ab, die leuchten, piepen und trillern kann. Als ich sie, wieder daheim, meinem Freund schenkte, erkannte ich, ich hätte dem Händler am besten einen ganzen Schlag dieser Tauben abgekauft. Ein geniales Geschenk für lustige, große Jungen. Sie wissen sofort, wohin man sie sich halten muss.
 Ein echter Hund spielte inniglich mit einem Plastikbecher auf einem nächtlichen Platz.
Ein echter Hund spielte inniglich mit einem Plastikbecher auf einem nächtlichen Platz.
Vor einem Galahotel sehen wir Bruce Weber, den Regisseur und Fotograf, aus einer glamourösen Limousine steigen. Ein nett wirkender, molliger, entspannter Mann, inmitten von Fans und Entourage. Er ist wegen seiner beiden Filme hier – dem über Chet Baker und dem über Robert Mitchum, der hoffnungslos ausverkauft war.
The Friends of Eddie Coyle (Peter Yates, 1973). Als Mann kurz vor dem Rentenalter kommt mir Mitchum noch mehr eins mit sich selber vor. Das unausgewogene Schwanken ist verschwunden. Gefasst, gesammelt und verdichtet, ist er ein imposanter, abgespannter ehemaliger Krimineller, der keinen Ehrgeiz mehr hat, etwas zu bedeuten und zu reißen in der Welt der Männer. Er ist nur noch privat hier, einer von vielen, der im Hockeystadion Bier aus Pappbechern trinkt und maßvoll seine Mannschaft anfeuert. Trotzdem ist er jemand Besonderes, so wie alle in dem Film: alles alltägliche, aber hochinteressante Leute. Mitchum lebt mit einer unglamourös aussehenden Frau zusammen, die er ebenso herzlich und etwas unkonzentriert küsst wie in früheren Rollen Schönheiten und Stars. Er will sich mit ihr und den Kindern zur Ruhe setzen. Nur vorher ein paar Kröten zusammenzukratzen, alte Geschichten abschließen. Es ist ein aufregend zu verfolgendes Machtausloten, Reden und Verhandeln, in das er sich dafür begibt, mit verschiedenen Gangster-„Freunden“, in dunklen, hinreißend banalen Wirtschaften und an beiläufig abgeranzten Unorten. Mit den Jüngeren geht er ruhig und müde um, lässt sich nichts vormachen, nimmt sich Zeit und lässt sie sich nicht wegnehmen. Das resignierte Leben erscheint ungewöhnlich groß; man staunt, wie vielschichtig und tief es ist. 9/10
Drums along the Mohawk (John Ford, 1939). 1939 war ein schreckliches Jahr. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass dieser Film oft so überzeugt stramm steht, als fühlte er sich einberufen.
Im Mittelpunkt steht eine deutsch geprägte Siedlergemeinde. Fidele volkstümliche Originale, die sich foppen und vertragen. Ein junger Mann und eine taffe, alte Frau (Edna May Oliver) tun so, als flirteten sie. Das ist ihr kleines Spiel. Noch auf dem Sterbebett verabschiedet sie sich von ihm mit „Leb wohl, schöner Mann!“. Das finde ich nett. Handfest-komisches Bauerntheater ist auch die Szene, in der zwei betrunkene Indianer bei ihr einbrechen und ihr Ehebett verbrennen wollen; sie schlägt einen mit der Faust nieder, aber da weiß ich schon nicht mehr…
Lana (Claudette Colbert) und Gilbert Martin (Henry Fonda) sehen wir zu Beginn noch an der bürgerlich-kultivierten Ostküste heiraten. Dann geht es in den wilden Westen. Gilbert hat dort ein Holzhaus gebaut. Lana ist, als sie es sieht, schockiert von der Primitivität, in der sie leben soll, und kann sich nicht freuen. Gilbert sieht sein Haus auf einmal auch mit Lanas Augen und wird unsicher. In dem Moment latscht grußlos Gilberts knarziger, gewollt lustignamiger Freund „Blue Back“ herein. Man hat Lana vor Indianern wie ihm gewarnt, sie kriegt einen Riesenschrecken, weint, alles ist fremd und furchtbar, sie will zurück zu ihrer Familie. Gilbert greift zum alten Hausmittel und schlägt Lana ins Gesicht. Entschuldigt sich erschrocken. Blue Back überreicht ihm kühl eine Rute für den Fall, dass sich solche Dinge wiederholen: Lana sei sicher eine gute Frau, aber auch solche würden durch Schläge nur noch besser. Gilbert überlegt, die Rute ins Feuer zu werfen. Dann aber legt er sie vorsichtig auf sein Kaminsims. Man weiß ja nie.
In zwei Kriege ziehen Gilbert und seine Freunde. Der erste gegen die Indianer: Man will weiter nach Westen, die Indianer schießen einen dafür tot und brennen einem die Dörfer nieder. Da muss man sich wehren; die Siedler betrachten das als rechtmäßig. Es geschieht in manchmal klassisch schönen Bildern. Wenn Gilbert vor drei Verfolgern wegläuft, sieht man sie wie Schattenrisse vor einem dunkel flammenden Himmel.
Mit einem zweiten Krieg wollen die Kolonisten sich von England trennen. Auch dafür lohnt sich die Mobilmachung zum Töten und Sterben. Der Pfarrer bittet Gott um Verzeihung, schießt und grämt sich nachher, irgendwo am Rande. Lana fleht Gilbert an, bei ihr und dem gemeinsamen Kind zu bleiben (es ist ein Junge: „Ich habe das so sehr gehofft!“, sagt Lana nach der Entbindung). Gilbert bittet sie bekümmert, trotzdem zu sagen, sie sei stolz, wenn er kämpft. Sie tut es, ihm zuliebe.
Der Film nimmt Einwände gegen seine Message ernst. Er stellt sie dar – und macht, dass die Ereignisse sie widerlegen. Am Ende sind selbst die Pazifisten von der Notwendigkeit und Unausweichlichkeit der Kriege überzeugt: Man muss sich straffen, uniformieren und zu Waffen machen, wenn das Vaterland ruft. Viele sind gestorben (ein netter Mann bei der Amputation seines Beines usw.), die Siedler haben ein Massaker angerichtet. Gilbert kommt mit heilen Gliedern und wundersam gesunder Seele wieder heim. Dann stehen sie als Sieger ergriffen vor der neuen Flagge. Lana platzt naiv heraus, die sei aber wirklich schön. Das sorgt für erleichternde Belustigung. Die Siedler wischen sich die letzten Tränen fort und schmunzeln fast schon wieder.
Ich hab das selten, aber bei diesem Film liegen mir die Botschaften so auf dem Magen, dass mir der Blick für die auf anderen Ebenen sicher vorhandene Qualität abhandenkommt. Nur Gilbert zuliebe: 6/10

 Ich habe das Gefühl, dass es mich verändert, den Schauspielern dabei zuzusehen, wie jeder das fragile, flüchtige Man-selber-Sein und Jemand-anderes-Sein auf seine Weise angeht. Es führt mir vor Augen, wie ich sein könnte oder vielleicht in einer anderen Wirklichkeit auch bin. Filme verwandeln unseren genetischen Code, hat Klaus Lemke gesagt.
Ich habe das Gefühl, dass es mich verändert, den Schauspielern dabei zuzusehen, wie jeder das fragile, flüchtige Man-selber-Sein und Jemand-anderes-Sein auf seine Weise angeht. Es führt mir vor Augen, wie ich sein könnte oder vielleicht in einer anderen Wirklichkeit auch bin. Filme verwandeln unseren genetischen Code, hat Klaus Lemke gesagt.
Abgesehen von Robert Mitchum, fielen mir in Bologna besonders unglückliche Mädchen auf. Ruth Leuwerik, O. W. Fischer, Maria Orska, Mary Nolan, Maria Maddalena, Maria Goretti… als wir an einem späten Abend in unsere Ferienwohnung in Bologna zurückkamen, lasen wir, dass eine Genossin vieler gemeinsam besuchter Filmveranstaltungen sich umgebracht hatte. Ohne ihre Geschichte eigentlich zu kennen, war sie mir immer ein bisschen so vorgekommen wie eines der glühenden und schwankenden Mädchen aus den Filmen, die wir sahen, mit ihren zerfetzten Herzen und dem lauten Lachen. Nun hatte sie sich aus dem Leben katapultiert. Wie die Mädchen in den Filmen, die mir so leidtun, hielt sie den Schmerz nicht aus, den es mit sich bringt.
Ich spüre die Verbundenheit. Aber ich will, wenn möglich, nicht in die Tanzspuren dieser Seelenverwandten treten und mich nicht von Montgolfieren stürzen. Wenn man sich das aussuchen könnte, dann wollte ich von allen Filmleuten 2017 am liebsten Robert Mitchum sein.
 Auf einem Herren WC in einem Café am Rande der CSD-Parade in Bologna, wo eine Freundin und ich freundlicherweise zur Toilette gehen durften, fand ich auf dem Boden dieses Kommunionskindkränzchen.
Auf einem Herren WC in einem Café am Rande der CSD-Parade in Bologna, wo eine Freundin und ich freundlicherweise zur Toilette gehen durften, fand ich auf dem Boden dieses Kommunionskindkränzchen.
*
*
*























































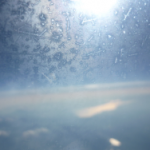










Ein Kommentar zu "Filmtagebuch einer 13-Jährigen #21: Il Cinema Ritrovato 2017"
Trackbacks für diesen Artikel